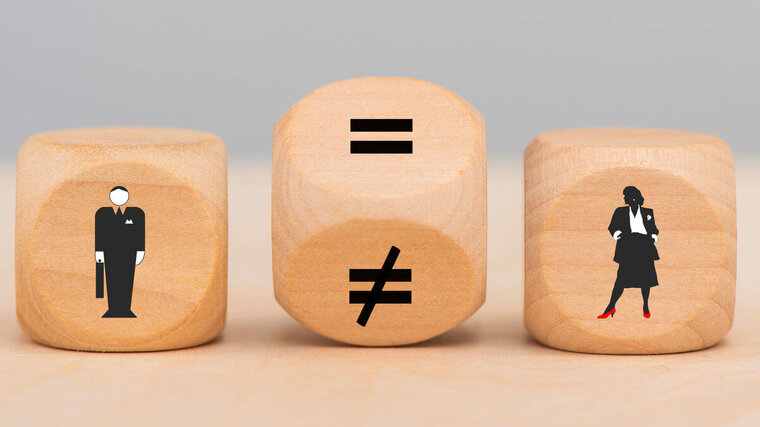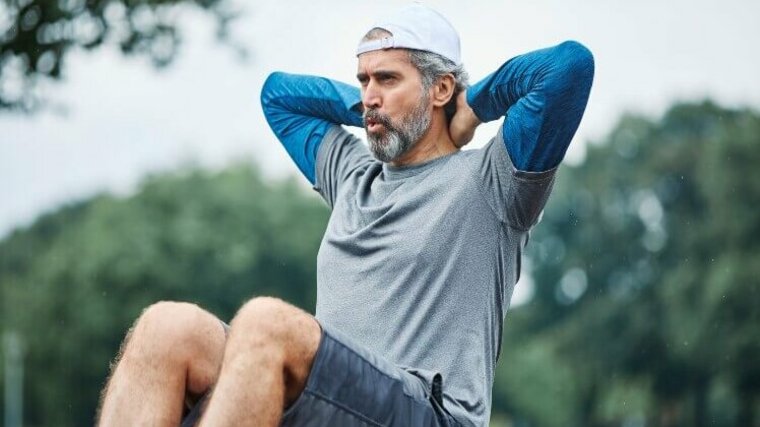Gender Health Gap - Ungleichheiten mit spürbaren Folgen
Ob Herzinfarkt, Depression oder Wechseljahre: Frauen und Männer werden nicht nur unterschiedlich krank, sie werden oft auch ungleich behandelt. Was das für Prävention, Unternehmen und unsere Gesundheit bedeutet, erklären Dr. med. Anne-Kathrin Collisi und Dr. med. Herbert Sterzik.
Prävention

Der Gender Health Gap beschreibt das Ungleichgewicht in der medizinischen Behandlung von Frauen und Männern.
Lange Zeit orientierte sich die Gesundheitsforschung an männlichen Patienten. Die Konsequenz daraus ist, dass Behandlungsmethoden auf männliche Bedürfnisse abgestimmt werden. Die Körper von Frauen und Männern unterscheiden sich jedoch in einigen Aspekten. Deswegen kann das Ganze schwerwiegende Folgen haben.
Frauen erhalten häufiger Fehldiagnosen, Medikamente wirken anders als erwartet und wichtige Symptome werden übersehen. Dieses Ungleichgewicht war selten beabsichtigt, sondern entwickelte sich schleichend und blieb lange unbemerkt.
Erst das Bewusstsein für den Gender Health Gap eröffnet die Möglichkeit, gezielte Lösungen zu entwickeln und Prävention sowie Behandlung endlich geschlechtergerecht zu gestalten.
Anlässlich des Movember und dem Weltmenopausentag:
Interview mit Dr. med. Anne-Kathrin Collisi, Expertin für Frauengesundheit, und Dr. med. Herbert Sterzik, Experte für Männergesundheit, über die Bedeutung gendersensibler Medizin, die größten gesundheitlichen Risiken und warum Prävention in Unternehmen immer wichtiger wird.
Dr. med. Anne-Kathrin Collisi
Leitende Ärztin ias PREVENT Berlin, Mitglied der Geschäftsleitung, Fachärztin für Innere Medizin, Gesundheitsförderung und Prävention (BÄK), Ernährungsmedizin (DGEM), fachgebundene genetische Beratung (BÄK), Schwerpunkt geschlechtergerechte Medizin

Warum ist eine geschlechterspezifische und gendersensible Medizin so zentral für eine zeitgemäße Prävention?
Dr. Collisi: Weil sie aufdeckt, was jahrzehntelang übersehen wurde. Männer und Frauen unterscheiden sich nicht nur äußerlich, sondern in nahezu allen biologischen Prozessen – bis hin zur Zellebene. Dennoch wurde medizinisches Wissen lange überwiegend aus der Sicht des „Standardmannes“ entwickelt. Das hat zur Folge, dass Frauen häufiger Fehldiagnosen erhalten oder Medikamente anders wirken als angenommen.
Dr. Sterzik: Und das zeigt sich in konkreten Risiken. Nehmen wir die koronare Herzkrankheit (KHK). Bei Männern treten Herzinfarkte früher auf, bei Frauen häufig erst nach der Menopause, aber mit deutlich höherer Sterblichkeit. Trotzdem sind Frauen in Studien oft unterrepräsentiert, ihre Symptome werden als „atypisch“ abgetan. Dabei sind es nicht selten klassische Anzeichen, nur eben anders: Kurzatmigkeit, Übelkeit, Rückenschmerzen statt Brustdruck.
Können Sie weitere Erkrankungen nennen, bei denen sich geschlechterspezifische Unterschiede klar zeigen?
Dr. Collisi: Nehmen wir Osteoporose: Jede vierte Frau über 50 ist betroffen, deutlich mehr als an Brustkrebs Erkrankte. Trotzdem wird kaum darüber gesprochen. Auch Bluthochdruck ist ein Thema. Bei Frauen steigt der Blutdruck häufig nach der Menopause deutlich an, stärker als bei Männern und mit deutlicheren Folgen, da das Risiko für Schlaganfälle bei ihnen schon ab niedrigeren Werten erhöht sein kann. Dennoch erhalten sie oft keine optimale Therapie.
Dr. med. Herbert Sterzik
Leitender Arzt ias PREVENT Frankfurt/Main, Mitglied der Geschäftsleitung, Facharzt für Innere Medizin/Flugmedizin/ Notfallmedizin/Sportmedizin, Flugmedizinischer Sachverständiger, Ernährungsmedizin (DGEM), Männermedizin (cmi)/Präventivmedizin (DAPM)

Dr. Sterzik: Auch bei Männern gibt es Aufklärungsbedarf. Erektionsstörungen zum Beispiel. Was viele nicht wissen: Sie können ein Frühzeichen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein. Studien zeigen, dass ein Herzinfarkt fünf bis acht Jahre nach einer Erektionsstörung folgen kann. Oder Testosteronmangel – er kann sich auf Stoffwechsel, Stimmung und sogar die Knochendichte auswirken, wird aber selten betrachtet.
Gibt es Unterschiede in der Medikamentenwirkung?
Dr. Collisi: Ja – teils gravierend. Frauen haben einen höheren Körperfettanteil, was die Speicherung von fettlöslichen Medikamenten beeinflusst. Ihre Hormonlage verändert zudem die Darmmotilität, Leberenzyme und Nierenfunktion sind anders. All das wirkt sich auf die Aufnahme und Verstoffwechselung von Arzneimitteln aus. Trotzdem basieren viele Medikamente auf Studien mit männlichen Probanden – erst seit 2004 ist es gesetzlich vorgeschrieben, beide Geschlechter gleichwertig zu untersuchen.
Dr. Sterzik: Und das hat Folgen: Frauen reagieren empfindlicher auf bestimmte Wirkstoffe, erleben häufiger Nebenwirkungen, erreichen bei vielen Medikamenten mit geringerer Dosis die gleiche Wirkung. Eine geschlechterspezifische Betrachtung wäre nicht nur medizinisch sinnvoll, sondern würde auch Kosten senken – durch weniger Nebenwirkungen, bessere Wirksamkeit und höhere Therapietreue.
Was bedeutet das für die betriebliche Gesundheitsförderung?
Dr. Sterzik: Sehr viel. Geschlechterspezifische und gendersensible Prävention ist ein Schlüsselfaktor für langfristige Gesundheit – und damit für Leistungsfähigkeit. Wenn Frauen in den Wechseljahren unter Schlafstörungen oder Konzentrationsproblemen leiden, aber dieses Thema in Unternehmen tabu ist, führt das oft zu Präsentismus oder sogar zu Karriereabbrüchen. Dabei ließe sich durch gezielte Aufklärung und medizinische Angebote viel verbessern.
Dr. Collisi: Wir müssen Prävention individuell denken. Männer sprechen seltener über psychische Belastung, die Dunkelziffer für nicht erkannte psychische Erkrankungen ist hoch. Frauen leiden häufiger an Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto oder rheumatoider Arthritis, auch weil ihr Immunsystem anders und aktiver ist – aber auch anfälliger für Fehlsteuerungen. Ein betriebliches Gesundheitsmanagement muss diese Unterschiede kennen und einbeziehen.
Nichttraditionelle und frauenspezifische Risikofaktoren
Neben den klassischen Risikofaktoren wie Bluthochdruck oder Rauchen gibt es bei Frauen zusätzliche, oft übersehene Risiken. Dazu gehören unter anderem Autoimmunerkrankungen, chronische Entzündungsprozesse, hormonelle Veränderungen (z. B. nach Schwangerschaften oder in den Wechseljahren), Schwangerschaftskomplikationen sowie psychische Belastungen durch die Mehrfachbelastung in Familie und Beruf. Diese Faktoren beeinflussen insbesondere die Herz-Kreislauf-Gesundheit, werden jedoch in der Praxis bislang häufig unterschätzt. Eine gendersensible Prävention berücksichtigt genau diese Unterschiede und ermöglicht so eine gezielte, individuelle Vorsorge.
Welche ökonomische Relevanz hat der Gender Health Gap?
Dr. Collisi: Eine enorme. Laut des Berichtes des Weltwirtschaftsforums 2024 kostet die ungleiche Versorgung von Frauen die Weltwirtschaft jährlich rund eine Billion Euro. Allein die bessere Versorgung bei Menopause und Endometriose könnte laut Studien bis 2040 rund 130 Milliarden Euro zusätzlich zum globalen BIP beitragen. Das zeigt: Es geht nicht nur um Gerechtigkeit, sondern um wirtschaftliche Nachhaltigkeit.
Dr. Sterzik: Auch bei Männern gibt es große Herausforderungen. Eine unerkannte Depression oder ein nicht diagnostizierter Diabetes führt zu Fehlzeiten, Produktivitätsverlusten und langfristigen Ausfällen. Auch wichtig: es trifft auch die sogenannten „kranken Schlanken“ – Männer mit unauffälligem Erscheinungsbild, was häufig zu nicht entdeckten Risikofaktoren oder Erkrankungen führt. So sind es im jungen Erwachsenenalter häufiger Männer, die an Bluthochdruck erkranken. Frauen holen nach den Wechseljahren deutlich auf. Wer Prävention hier ernst nimmt, sichert nicht nur Gesundheit, sondern auch Stabilität im Unternehmen.
Was können Unternehmen konkret tun?
Dr. Collisi: Ein Anfang wäre, offen über das Thema zu sprechen – und entsprechende Angebote zu schaffen. Das kann eine medizinische Beratung zu den Wechseljahren sein, ein spezifischer Männergesundheits-Check oder Angebote zur Unterstützung der mentalen Gesundheit. Wichtig ist, dass Prävention als Teil der Unternehmenskultur verstanden wird – nicht als Ausnahme, sondern als Standard.
Dr. Sterzik: Schulungen für Führungskräfte helfen, sensibler mit den Themen umzugehen. Gerade bei Männern äußert sich psychische Belastung oft in Rückzug, Reizbarkeit oder exzessivem Verhalten. Bei Frauen werden diffuse Symptome wie Müdigkeit oder Schlafstörungen nicht selten vorschnell psychologisiert, obwohl dahinter z. B. eine Schilddrüsenerkrankung oder hormonelle Veränderung steckt. Wer diese Mechanismen kennt, kann besser begleiten.
Gesund bleiben, individuell und gendersensibel
Regelmäßige Check-ups sind ein zentraler Baustein, um gesundheitliche Risiken frühzeitig zu erkennen und gezielt vorzubeugen. Das Modul gendersensible Prävention setzt hier an und verbindet moderne Diagnostik mit einer individuellen Auswertung, die geschlechtsspezifische Unterschiede konsequent berücksichtigt. So entstehen Vorsorgekonzepte, die nicht nur die Gesundheit jedes Einzelnen stärken, sondern auch die Leistungsfähigkeit und Stabilität des gesamten Unternehmens sichern.
Ihr Wunsch für die Zukunft?
Dr. Collisi: Dass wir geschlechterspezifische, gendersensible und lebensphasenangepasste Prävention nicht länger als Ausnahme, sondern als Grundlage moderner Medizin und Arbeitskultur begreifen – zum Wohle der Einzelnen und der Gesellschaft.
Dr. Sterzik: Das Unternehmen Prävention neu denken – differenziert, personalisiert, vorausschauend. Mit circa 46 Millionen Erwerbstätigen ist das Arbeitsumfeld das größte Präventionssetting überhaupt! Das zu nutzen, lohnt sich – für alle.
Möchten Sie regelmäßig zu diesen Themen informiert werden?
Lesen Sie monatlich ausgewählte Beiträge und Hintergrundberichte im Newsletter „ias aktuell“. Jetzt aktuelle Ausgabe aufrufen und kostenfrei abonnieren:
Newsletter "ias aktuell"

Diesen Artikel teilen